| Newsnational |
Dienstag, 09.09.2025 |  Drucken Drucken |
25 Jahre NSU-Morde: Grundstein für das Komplettversagen
Wie die Behörden den ersten großen Homegrown-Terror der Dt. Nachkriegszeit wegen den eigenen Vorurteilen von Anfang an übersahen
Nürnberg, 9. Januar 2024 - Es war ein kalter Januartag, als Enver Şimşek, ein 38-jähriger Blumenhändler, auf seiner Verkaufsroute nahe Nürnberg niedergeschossen wurde. Er war das erste von zehn Mordopfern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). Doch die Ermittlungen der bayerischen Behörden, die an diesem 9. Januar 1999 begannen, waren weniger von der Suche nach der Wahrheit geprägt als von schädlichen Klischees. Sie waren der Startschuss für eines das größte Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden der Nachkriegszeit. Bereits in den ersten Stunden nach der Tat wurde die Weiche in die falsche Richtung gestellt. Statt alle Möglichkeiten auszuloten, konzentrierten sich die Fahnder sofort auf das vermeintlich vertraute Feindbild: die kriminelle Ausländer-Szene. Ohne jegliche Beweise wurde die Tat als „Drogendelikt“ oder „Ehrenmord“ im Milieu der türkischen Community eingeordnet. Das integrierte Leben des Familienvaters Şimşek passte nicht in dieses Bild – und wurde ignoriert. Dabei gab es konkrete Hinweise, die in eine ganz andere Richtung wiesen. Ein Zeuge berichtete der Polizei von einem auffälligen weißen Kombi – einem Renault 19 – mit zwei „deutsch“ aussehenden Männern am Tatort. Eine entscheidende Spur. Doch im ersten offiziellen Fahndungsaufruf fehlte jede Erwähnung des Fahrzeugs oder der Täterbeschreibung. Der Hinweis versickerte in den Akten und geriet für Jahre in Vergessenheit.
Eine tief verwurzelte, rassistische Verzerrung der Wahrnehmung verhinderten, die Mordserie als das zu erkennen, was sie war: terroristische Gewalt von Rechts. Die Fantasiefigur des „Dönermörders“ war geboren – ein Phantom, das die Behörden jahrelang in der migrantischen Community suchten, anstatt bei der eigenen weißen Mehrheitsgesellschaft
Stattdessen durchkämmte die Polizei wochenlang das soziale Umfeld des Opfers und belastete Unschuldige. Was wie ein bedauerlicher Einzelfehler wirken mag, entpuppt sich als Muster. Diese initiale Fehleinschätzung war der Prototyp für die Ermittlungen zu allen folgenden NSU-Morden. Die Ermittler von einheitlicher „Rechtsextremismus“-Abteilung, keine länderübergreifende Zusammenarbeit und eine tief verwurzelte, rassistische Verzerrung der Wahrnehmung verhinderten, die Mordserie als das zu erkennen, was sie war: terroristische Gewalt von Rechts. Die Fantasiefigur des „Dönermörders“ war geboren – ein Phantom, das die Behörden jahrelang in der migrantischen Community suchten, anstatt bei der eigenen weißen Mehrheitsgesellschaft. Dieses Narrativ war so mächtig, dass selbst nach dem achten Mord und der Entdeckung der rassistischen Bekennervideos im Jahr 2011 die Zweifel nur langsam bröckelten. Der Fall Enver Şimşek zeigt: Das spätere Komplettversagen um den NSU begann nicht erst mit dem Auffliegen des Trios oder der Vernichtung von Akten. Es begann am allerersten Tatort. Es war ein "systemisches Versagen", wie der DER SPIEGEL jüngst schrieb, das sich auf Vorurteile, institutionelle Blindheit und mangelnde Sensibilität für rechte Gewalt gründete. Die Folgen dieses Versagens sind bis heute spürbar. Es zerstörte das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung in den Rechtsstaat. Die Frage, warum der Hinweis auf den weißen Kombi nicht ernst genommen wurde, bleibt eine der schmerzhaftesten und unbeantworteten des gesamten NSU-Komplexes. Sie ist ein Symbol dafür, dass die Aufklärung dieser Morde nicht erst 2011 begann, sondern 1999 schon einmal gründlich verspielt wurde.
|
|
Hintergrund/Debatte
Unpatriotisch in AfD-Manier: Syrien-Phantomdebatte der Union ist verlogen, geht an der Sache vorbei und untergräbt die wirtschaftlichen Chancen und die Rolle Deutschland im Nahen Osten einmal mehr - Aiman A. Mazyek
...mehr
Zerstört und am Boden: Was Syrien vom Wiederaufbau Deutschlands, Japans und Vietnams lernen kann – und warum was bisher unmöglich ist. Hier eine Pro- und Contra Sicht
...mehr
Sant’Egidio: Angesichts der Dramen von Krieg und Flucht die Humanität nicht verlieren
...mehr
Die deutsche Erinnerungskultur und die Übertragung von Schuld- Warum Muslime oft zur Projektionsfläche für die Schuldenlastung werden
...mehr
Buchrezension: „Religion und Diplomatie – Ein Blick aus Wissenschaft, Politik und Religionsgemeinschaften“ (Herausgegeben von Dr. Heinrich Kreft, Botschafter a.D.)
...mehr
Der Koran – 1400 Jahre, aktuell und mitten im Leben
Marwa El-Sherbini: 1977 bis 2009
|
 Die Pilgerfahrt (Hadj) - exklusive Zusammenstellung Dr. Nadeem Elyas
Die Pilgerfahrt (Hadj) - exklusive Zusammenstellung Dr. Nadeem Elyas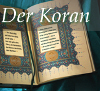 Auf islam.de:
Auf islam.de:



